Prolog (aus meinem Buch Alpenradler)
Liebe auf den zweiten Blick
Der schlimmste Tag in meinem Grundschul-Leben war ein Donnerstag.
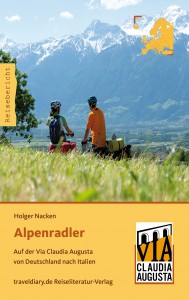
An diesem Tag sollte in der vierten Klasse der katholischen Grundschule Erzbergallee in Aachen die Fahrradprüfung stattfinden. Eigentlich war alles klar. Ein netter Verkehrs- polizist hatte uns bestens vorbereitet. Der freundliche Mann, in meiner Erinnerung trägt er einen buschigen Seehundschnäuzer und eine etwas spack sitzende grüne Uniformjacke, war mit uns den ganzen Prüfungsweg sogar vorher einmal gemeinsam abgegangen. Der Herr Ver- kehrswachtmeister hatte uns genau gezeigt, wo wir rechts- vor-links beachten mussten, und angedeutet, dass das jetzt keine knallharte Prüfung werden würde. Kein Grund also für Prüfungsstress. Es gab nur ein kleines Problem: Ich konnte gar nicht Fahrradfahren.
Das aber war in meiner Schule nicht bekannt. Ich hatte mir das Horrorszenario genau ausgemalt. „So, Holger, du bist dran, dann fahr mal los“, hätte unsere nette Klassenlehrerin Frau Hahn gesagt. Ich hätte etwas rumgedruckst, vielleicht versucht loszufahren und wäre ungelenk zur Seite gekippt. Ich hätte eine Entschuldigung gemurmelt, es tapfer noch einmal probiert, wäre diesmal zur anderen Seite umgefal- len. Hätte dann alles gestanden und schließlich die Fahr- radprüfung absolviert, indem ich unter dem Gekicher meiner Mitschüler (und der Mitschülerinnen!) die Strecke schiebend absolviert hätte.
Es dürfte verständlich sein, dass ich an besagtem Donnerstag leider krankheitsbedingt fehlte. Wobei ich dazusagen muss: Ich hatte wirklich Fieber und eine heftige Erkältung. Aber die war wahrscheinlich psychosomatisch.
Was ich damit sagen will: Es war nicht unbedingt eine Liebesheirat mit mir und dem Fahrrad. Mein Vater hat es erst später in unserem Hauspark, dem Frankenberger Park, geschafft, mir beizubringen, wie man auf zwei dünnen Reifen das Gleichgewicht hält. Da war ich schon auf dem Gymnasium. Nach und nach habe ich mich trotzdem mit dieser Fortbewegungsart angefreundet. Mittlerweile kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne gehen soll. Ich fahre damit zur Arbeit und auch sonst fast jeden Meter durch Köln, weil es in dieser Stadt die schnellste und ange- nehmste Form der Fortbewegung ist. Längere Touren im Urlaub hatte ich bisher trotzdem nicht zurückgelegt. Ich gehörte bisher eher zur reinen Wanderfraktion. Das aber sollte sich ändern.
Die Sache begann mit einem Artikel in „Panorama“, der Mitgliederzeitschrift des Deutschen Alpenvereins. In der Frühjahrsausgabe berichtete das Magazin über den Radweg „Via Claudia Augusta“. Dieser führt auf einer alten römischen Kaiserstraße über mehr als 700 Kilometer von Bayern aus über die Alpen. Wow, Alpenüberquerung! Hannibal in einer Woche schaffen! Große Freiheit auf zwei Rädern! Irgendsolche Gedanken müssen es gewesen sein, die mich dazu brachten, den Infokasten aus dem Artikel einzuscannen und an meine beiden Reisekumpane zu schicken, mit denen ich fast jedes Jahr eine rund einwö- chige Wandertour in den Bergen unternehme. Das Echo auf meine Email-Versandaktion war an Eindeutigkeit nicht zu übertreffen. „Klasse“ und „prima, mal was anderes“ ließen bei unserer etwas bierseligen Tourbesprechung in einer Aachener Kneipe keinen Spielraum für Interpretationen. Aus der Nummer kam ich nun nicht mehr raus, obwohl sich meine Fahrradtourenerfahrung bislang auf eine Fahrt von Köln nach Koblenz beschränkte – zu einem Auswärtsspiel des Fußballvereins Alemannia Aachen, dessen Fan ich seit meinem zehnten Lebensjahr bin. Doch die anderen beiden brachten auch nicht mehr Bike-Trekking-Expertise mit. Und so beschlossen wir einhellig, die „leichteste Überquerung der Alpen mit dem Fahrrad“ im folgenden Sep tember anzugehen.
Über die Dinge, die wir dort erlebt, und Menschen, die wir dort getroffen haben, berichte ich in diesem Buch. Es treten unter anderem auf: krampfader-interessierte E-Book-Leser, pflaumenfixierte Geocacher, punkige Blas- kapellen, liebestolle Ärzte und noch einige mehr. Der Text soll bewusst kein rein nutzwertiger Reiseführer sein. Dazu gibt es schließlich schon hervorragende Fachliteratur, die ich im Reisetippteil am Ende des Buches erwähne. Es geht mir darum, Geschichten vom Unterwegssein zu erzählen. Und vielleicht die Lust darauf zu wecken, sich ebenfalls einfach aufzumachen. Vielleicht ja sogar zu eben solch einer Radtour über die Alpen.
Pampers und Pedale – Die Vorbereitung
„Was? Alpenüberquerung? Einfach so, wo ihr sonst noch nie länger mit dem Rad unterwegs wart?“ Tanja, meine Frau, zweifelt doch ein wenig an unserer Entscheidung, als ich ihr stolz von unserem Vorhaben erzähle. Oder, um es mit ihren Worten zu sagen: „Ihr seid doch total bescheu- ert.“ Nun, Diplomatie war noch nie ihre größte Stärke. Immerhin verlangt sie nicht gleich von mir, dass ich sie endlich als Begünstigte meiner Lebensversicherung eintrage. Aber das kann ja noch kommen, wenn die Tour erst näher rückt. Hatte ich sowieso vor.
Ist Tanjas grundsätzliche Haltung eher skeptisch, unterstützt sie mich in der Praxis aber nach Kräften. Das ist auch dringend notwendig. Zum Beispiel bei handwerkli- chen Dingen. Da ist Tanja ohnehin die Geschicktere von uns beiden und auch nicht umsonst im Haushalt die offizi- elle Beauftragte, wenn es etwa darum geht, das Ikea-Regal Lillesund aus 348 Einzelteilen zusammenzusetzen. In der Tourvorbereitung geht es erst einmal um weniger komplexe Projekte, die mich gleichwohl auch zur Verzweiflung brin- gen. Eins besteht zum Beispiel darin, diesen verdammten Wasserflaschenhalter am Rahmen des Fahrrades zu befes- tigen. Ich habe das schon gefühlt eine Stunde probiert. Hätte ich doch gleich meine Frau gefragt. „So, das Ding hält“, verkündet sie, als sie mir nach zwei energischen Dre- hungen den Schraubendreher wieder zurück gibt. „Aber glaub nicht, dass ich auf die Tour mitkomme und hinter euch her schraube.“
Total OP
Besser ist es, ich mache einen Termin beim Fahrradklempner, um mein Rad zum Rundum-Check vorzustellen. Der Mann – Latzhose, Schnurrbart, Typ kölsches Original – reagiert ebenfalls ein wenig skeptisch, als ich von unserem Vorhaben berichte. Ja, die Via Claudia kenne er. Habe er auch schon gemacht. Vor 20 Jahren. Mit dem Motorrad natürlich.
Nun denn, Bike ist Bike. Immerhin hält er mein Merida- Tourenfahrrad grundsätzlich für geeignet und verspricht, sich in drei Tagen mit einer konkreten Diagnose zu melden. Das übernimmt dann ein Kollege. Ob er sich selber nicht getraut hat? Den Inhalt des Gespräches werden Autobe-
sitzer von diversen Werkstattrückmeldungen kennen. Es enthält Bestandteile wie „leider komplett hinüber“, „über- legen, ob man nicht lieber gleich neu kauft“ und „am besten noch mal persönlich besprechen“. Um es kurz zu machen: Die Zähne des Antriebs sind in Ordnung, nur der Rest muss raus. Also: Schaltung, Kette, Umwerfer, Kassette und wie diese Dinge sonst noch heißen – alles sollte besser ausgetauscht werden. Macht inklusive Mon- tage mal eben 330 Einheiten der europäischen Krisen- währung. Natürlich könne man es auch eher provisorisch reparieren, aber dann sei es wahrscheinlich, dass irgend- wann die Kette abspringt und nicht wieder draufgeht. Der Drahtesel-Doktor empfiehlt ohnehin die Investition in ein neues Rad.
Ist es ehrliche Sorge? Oder nur pure Geschäftstüchtigkeit? Schließlich steht der Laden voll mit nagelneuen Tourenrä- dern, die mit mindestens 600 Euro Kaufpreis ausgezeich- net sind. Auf der anderen Seite relativieren sich die Kosten eines neuen Rades beträchtlich, wenn ich die notwendigen Reparaturinvestitionen davon abziehe. Außerdem hatte ich mein derzeitiges Rad schon gebraucht von einem Freund gekauft, der mir damals stolz berichtete, was er für lange Radtouren durch Osteuropa damit gemacht habe. Wer weiß also, was noch alles demnächst an dem Rad seinen Geist aufgibt? Nachdem ich noch eine Nacht darüber geschlafen habe, ist die Entscheidung für mich klar: Ich will mich doch so kurz vor Tourstart nicht auch noch an ein neues Rad und einen neuen Sattel gewöhnen. Die Zeit drängt sowieso. Also hole ich keine zweite Meinung ein und setze auf die bikechirurgische Total-OP. Eine Woche später radle ich mit neuem Antrieb vom Fahrradhof, klick, klack, surr. Kette und Schaltung laufen wie geschmiert und sind es hoffentlich auch. Nur treten muss ich noch selber.
Von Mamils und Menschen
Doch mit der Fitnesskur für mein Rad ist die Vorbereitung natürlich nicht abgeschlossen. Es gibt schließlich noch zahlreiche Ausrüstungsfragen zu klären. In mir keimt die Frage, die mir sonst Tanja stellt, wenn wir mal zu einer Hochzeit eingeladen sind: „Was zieh ich bloß an?“ Gerne variiert auch mit der Feststellung: „Ich habe überhaupt nichts anzuziehen!“
Sich kleidungstechnisch an der Sportrad-Szene zu orientieren, ist keine Option. Nicht wenige Angehörige dieser verkehrstechnischen Subkultur hegen nämlich eine Vor- liebe dafür, sich in hautenge Leibchen zu zwängen. Dieser Leidenschaft huldigen augenscheinlich vor allem solche Herren und zunehmend auch Damen, die ihren Kör- pern derzeit eher keine große Ertüchtigung zumuten. Was wollen sie uns sagen? Schaut her, das Trikot hat mir einmal gepasst? Der Stoff hält alles zusammen? Zusätzlich zum engen Schnitt ist es offenbar unabdingbar, dass das Kleidungsstück werbemäßig voll genutzt wird. Ob Rennstall Niederdollendorf-Süd oder Team-Telekom: Kein Quadratzentimeter der kostbaren Textilfläche bleibt unbeflockt. Mitunter wählen die Herrschaften zumindest den Aufdruck passend zum Erscheinen. Am Rheinufer entdeckte ich vor kurzem einen XL-Biker im XS-Outfit, dessen Werbung auf der knallengen roten Pelle besonders zutraf: Meica. Sein Aussehen war dem Mann offenbar wurst.
Mein Freund Tom – selbst ein begeisterter Radsportler – berichtete mir davon, dass Vertreter dieser Spezies in der Szene als „Mamil“ bezeichnet werden. Das steht für „Middle aged man in Lycra“. Also für einen Herrn in den besten Jahren, der sich in Textilen aus der Kunststofffaser Lycra gewandet. Trikots aus diesem Chemieprodukt, auch als Elastan bekannt, passen sich durch ihre Dehnbarkeit nicht nur jeder Körperfalte an, sondern gelten zudem in Verbindung mit Schweiß auch noch als besonders geruchs- intensiv. Da helfen offenbar selbst keine Silberionen und andere Chemie-Ausrüstungen: Nach ein paar Stunden sportlicher Aktivität riecht der Träger wie ein in Plastik eingewickelter Fischkadaver. Das Phänomen kenne ich von diversen sommerlichen Stadionbesuchen. Denn offen- bar sind auch Fußballtrikots aus ähnlich geruchsintensi- vierenden Stoffen hergestellt. Die sorgen dafür, dass die Fans ein olfaktorisches Problem verursachen, auch wenn sie sich selber kaum sportlich bewegen. Da reicht schon das einfache Mitfiebern mit dem eigenen Team. Richtig schlimm wird es dann, wenn es um die eigene Körperhy- giene sowieso nicht zum besten bestellt ist – was in man- chen Teilen der Fanszene durchaus zu diagnostizieren ist. Daher ist es an heißen Sommertagen keinesfalls zu emp- fehlen, in überfüllte Stadionbusse einzusteigen – es sei denn, man hat gerade eine ziemlich alberne Mutprobe laufen. Vielleicht sollte ich so etwas einmal Joko und Klaas für Circus HalliGalli vorschlagen.
Doch die Bekleidungsbranche bemüht sich offenbar um Abhilfe. Ein Verkäufer in einem Fahrradladen in Köln berichtet mir davon, dass jetzt einige Trikot-Hersteller dazu übergehen, weniger Chemie-Fasern, sondern vor allem Merino-Wolle zu verarbeiten. Das Material stammt von Merino-Schafen, die für ihr besonders feines Fell bekannt sind. Die Fasern eliminieren tatsächlich sämtliche unangenehmen Gerüche und tragen sich sehr angenehm, auch direkt auf der Haut. Das Material kenne ich schon länger von meiner Wanderkleidung. Ist ja interessant, dass die Rad-Fraktion jetzt auch schon auf den Trichter gekommen ist. Die einschlägigen Hersteller betonen dabei allerdings vor allem bewusst die Retro-Optik und bringen werbetechnisch vorwiegend junge Herren mit Vollbärten an den Start. Passt ja auch: Wolle im Gesicht, Wolle auf dem Körper. Die Hipster-Welle schwappt weiter. Ohne mich allerdings, obwohl ich auf der Tour ebenfalls auf die tägliche Rasur verzichten werde.
